von Klaus Holzer
Ab Ende der 1790er Jahre überzog Napoleon Bonaparte ganz Europa mit Krieg, eroberte es, besetzte es, setzte Verwandte und Vertraute ein, es zu regieren, brachte unfaßbares Leid über die Menschen, jedoch auch den aus der französischen Revolution hervorgegangenen republikanischen Weckruf der Moderne, Liberté, Egalité, Fraternité ins noch feudale Europa. Nachdem er in der Völkerschlacht bei Leipzig endgültig besiegt worden war und er schließlich am 17. Juni 1815 sein Waterloo erlebt hatte, wurde daher eine territoriale Neuordnung des Kontinents notwendig. Dieses geschah zwischen 1814 und 1815 auf dem Wiener Kongreß. Als am 9. Juni 1815 die Schlußakte des Kongresses unterzeichnet wurde, wurde damit ein vorher nicht genau umrissenes Territorium namens Westfalen auf die Landkarte gesetzt, als preußische Provinz. In diesem Sommer wird das moderne Westfalen 200 Jahre alt.
 Stammesherzogtum Sachsen um 1000
Stammesherzogtum Sachsen um 1000
Aber natürlich ist Westfalen viel älter. Das alte Stammesherzogtum Sachsen bestand aus drei Teilen, dem westlichen Teil Westfalen, das sich von Friesland bis zum Rothaargebirge erstreckte, dem östlichen Teil Ostfalen, das von Lüneburg im Norden bis Merseburg im Süden reichte, dazwischen lag das Herzogtum Engern, das sich von Kassel im Süden bis nach Dänemark hin zog. Und wer hat nicht schon von dem Westfalen Widukind/Wittekind, dem Herzog Sachsens, gehört, der anno 777 erstmalig anläßlich des Reichstages von Paderborn erwähnt wird? Er war der Anführer der Sachsen (die Westfalen sind ein sächsischer Stamm, woher auch heute noch das Sachsenroß im niedersächsischen und das Westfalenroß im nordrhein-westfälischen Landeswappen herrühren) im Aufstand gegen Karl den Großen, wurde von diesem geschlagen und 785 getauft.


Sachsenroß & Westfalenroß
Nach Jahrhunderten als Flickenteppich disparater Gegenden, ohne staatliche oder territoriale Integrität, betrat Westfalen die politische Bühne, als Napoleon sich nach der Schlacht bei Jena und Auerstädt 1806/07 alle preußischen Gebiete westlich der Elbe einverleibte und 1807 das Königreich Westfalen mit Kassel als Hauptstadt gründete. Hier machte er seinen jüngsten Bruder Jérome zum König, der von seinen Untertanen nur König Lustik genannt wurde, weil sein deutscher Wortschatz angeblich nur aus „Guten Morgen, wieder lustig“ bestand. Das benachbarte Gebiet wurde zum Großherzogtum Berg erklärt, wozu auch Kamen gehörte.
Diese beiden Territorien sollten Modellstaaten nach französischem Vorbild werden. Alles wurde zentralisiert; der Code Civil (Code Napoleon) wurde einheitliche Rechtsgrundlage, alle Steuerprivilegien wurden abgeschafft, das französische Steuersystem eingeführt; die Bauern wurden aus der Leibeigenschaft befreit; es wurde eine Agrarverfassung eingeführt und das Gegenstück, gewerbliche Regulierungen; das Zunftwesen wurde abgeschafft; ein Toleranzgebot mit der Gleichberechtigung der Religionen entstand. Jedoch wurde auch die Wehrpflicht eingeführt, die strenge polizeiliche Überwachung der Bürger, und ein dichtes Spitzelsystem überzog die Gesellschaft.
All dieses wurde in den sechs Jahren französischer Herrschaft angestoßen und hatte nachhaltige Konsequenzen, obgleich die Westfalen die Fremdherrschaft als große Belastung empfanden und mit dem Erwachen patriotischer Gefühle darauf reagierten. Die von den Franzosen angestoßene Modernisierung in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft erwies sich als irreversibel.
Gleich nach der Niederlage Napoleons in der Völkerschlacht bei Leipzig 1813 besetzte Preußen, das alle seine westlichen Territorien an Frankreich verloren hatte, das Gebiet zwischen Rhein und Weser


Ludwig von Vincke
und etablierte eine provisorische Verwaltungsorganisation unter dem späteren äußerst populären ersten Westfälischen Oberpräsidenten Ludwig Freiherrn von Vincke, nach dem in Kamen inoffiziell die Brücke zwischen der Hochstraße und der Josefschule benannt ist, und schuf so bereits Fakten, bevor der Wiener Kongreß sich überhaupt konstituiert hatte. Am 30. April 1815 erläßt Preußen eine „Verordnung wegen verbesserter Einrichtung der Provinzialbehörden“ und überführt die provisorische Verwaltungsorganisation in eine dauerhafte.

Friedrich Wilhelm III. von Preußen
Dieses von Friedrich Wilhelm III. unterzeichnete Gesetz gilt als die „Geburtsurkunde“ Westfalens, auch wenn, oder vielleicht gerade weil es die Beschlüsse des Wiener Kongresses vorwegnahm. Damit erhält Westfalen zum ersten Mal in seiner Geschichte eindeutige politische Grenzen. Das war die Zeit, in der Preußen sich zum Modernisierungsmotor in Deutschland mauserte.
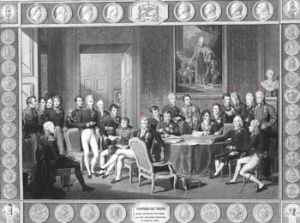
Wiener Kongreß
Schon am 21. Juni 1815, knapp zwei Wochen nach der Unterzeichnung der Schlußakte des Wiener Kongresses, erklärte es, ein neues System in Staat und Gesellschaft einrichten zu wollen: von der Staatsspitze über die staatlichen und militärischen Einrichtungen bis hin zur städtischen Selbstverwaltung (!). Treibende Kräfte der preußischen Reformen, die auch für Westfalen gelten sollten, waren der Freiherr Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein, der seinen Lebensabend auf Schloß Cappenberg verbrachte, und Karl August von Hardenberg. So steht die Gründung des politischen Westfalens am Beginn der Moderne.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hörte Preußen auf zu bestehen, und zwar durch das Gesetz Nr. 46 des Alliierten Kontrollrats vom 25.2.1947. Schon vorher aber hatte die britische Militärregierung am 23.8.1946 aus der preußischen Provinz Westfalen und dem nördlichen Teil der preußischen Rheinprovinz das Bindestrich-Land Nordrhein-Westfalen gebildet. Damit ging die Regierung für Westfalen von Münster auf Düsseldorf über. Und da das Fürstentum Lippe-Detmold den Wiener Kongress ohne territoriale Veränderungen überstanden und niemals zur Preußischen Provinz Westfalen gehört hatte, sondern immer selbständig geblieben war, am 21.1.1947 dann NRW statt Niedersachsen zugeschlagen wurde, hat NRW heute in seinem Landeswappen neben dem Rhein und dem Westfalenroß auch die Lippische Rose.

Wappen von NRW
Zu Preußen zu gehören, bot zu jener Zeit durchaus Vorteile, denn es schuf eine weitgehende Vereinheitlichung der Lebensumstände in seinen Provinzen, mit einer Ausnahme, dem Gerichtswesen, das erst am 1. Januar 1900 mit der Einführung des BGB diesen Stand erreichte.
1823 wurden durch Gesetz in allen preußischen Provinzen Versammlungen der Stände – das waren nicht vom Reich abhängige („mediatisierte“) Grafen und Fürsten, Adelige mit Rittergut, Bürger als Vertreter der Städte und Grundbesitzer auf dem Lande als Vertreter der Bauern -– eingerichtet, als Vorläufer eines zu schaffenden gesamtstaatlichen Parlaments.1826 eröffnete Oberpräsident von Vincke den ersten Westfälischen Provinziallandtag. Friedrich Wilhelm III. ernannte den Freiherrn vom Stein zum Landtagsmarschall, d.h., zum Vorsitzenden. Dieser Landtag setzte einen gewaltigen Modernisierungsschub in Bewegung.

Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein
Preußen initiierte eine Reformpolitik, die auf die Durchsetzung einer „bürgerlichen Ordnung“ abzielte. Dazu zählte die Schaffung einer berechenbaren Verwaltung und Justiz, das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen, die Emanzipation der Juden, die Städte erhielten eine neue Ordnung ebenso wie die ländlichen Gebiete, die Rahmenbedingungen für die gewerbliche Wirtschaft wurden durch ihre Befreiung von markthemmenden Zunftordnungen verbessert, Straßenbau, Schiffahrt, Eisenbahn, Zölle, Kreditwirtschaft und Versicherungen – alles wurde auf eine neue Grundlage gestellt, was in weiten Kreisen der Bevölkerung zur Akzeptanz der preußischen Herrschaft führte. Provinzialverwaltung und Provinzialparlament bildeten zusammen den Provinzialverband Westfalen, der manche Aufgaben effektiver lösen konnte als eine staatliche Zentralverwaltung (heute nennt man so etwas „Subsidiaritätsprinzip“). Gleichzeitig entstand dadurch eine größere Identifikation weiter bürgerlicher Kreise mit ihrer Provinz, so auch eine größere Legitimation der zentralen Herrschaft.

Preußische Provinz Westfalen
Am größten war der Widerstand gegen Veränderungen im Bereich des Adels, der Stände und des Bildungsbürgertums. Daneben bestanden von Anfang an Ressentiments zwischen dem protestantischen Westfalen, z.B. der Grafschaft Mark mit Kamen, Minden-Ravensberg und dem Siegerland, und den katholischen Gegenden, den Fürstbistümern Münster und Paderborn und dem Herzogtum Westfalen, d.h., dem Erzbistum Köln (die Kölner Erzbischöfe waren seit 1180 auch Herzöge von Westfalen). Hier wird deutlich, daß Westfalen zu Beginn des 19. Jh. ein Konglomerat aus disparaten wirtschaftlichen, sozialen, konfessionell-kulturellen und politischen Regionen war, was noch heute erkennbar ist, wenn man das Ruhrgebiet mit seiner früheren Industrie und der durch Zuwanderung aus Ost– und Südeuropa bedingten heterogenen Bevölkerung, z.B. mit dem immer noch stark ländlich geprägten Münsterland vergleicht.
Im Jahre 1840 war auch Kamen direkt von solchen Vereinheitlichungsbestrebungen betroffen. Seit 1744 gab es hier die „Kirche der größeren evangelischen Gemeinde“, die heutige Pauluskirche, und die der kleineren, die heutige Lutherkirche. Erstere war reformiert, d.h., calvinistisch, letztere lutherisch. Der preußische König, Friedrich Wilhelm III., gleichzeitig summus episcopus, der oberste Bischof der Kirche in Preußen, hatte 1817 verfügt, daß sich die verschiedenen protestantischen Landeskirchen zu einer Union zusammenschlössen, was die beiden Kamener Gemeinden auch unterschrieben, aber nicht in die Tat umsetzten, was jedoch durchaus nicht der königlichen Verfügung widersprach, da diese sich vor allem auf die organisatorische Seite bezog. Die echte Union kam erst 1920, als beide Kirchen auch ihre heutigen Namen bekamen.
Die nächste Etappe wurde von der 48er Revolution geprägt. Nachdem Friedrich Wilhelm IV. die ihm von der Frankfurter Nationalversammlung angebotene Kaiserkrone abgelehnt hatte und damit für die „Herrschaft kraft monarchischem Recht“ demonstriert hatte, wollte die republikanische Seite die Anerkennung der Reichsverfassung erzwingen. Daher kam es im Mai 1849 in Westfalen zu Aufständen. Eine der spektakulärsten Aktionen ereignete sich in Iserlohn, wo es in einer Schießerei zwischen märkischer Landwehr und preußischem Militär über 100 Tote gab, überwiegend Aufständische und Zivilisten.
Der Beginn der Industrialisierung in Westfalen in der Mitte des 19. Jh. verschärfte zunächst die Gegensätze zwischen den sich industrialisierenden Städten und den oft rückständigen ländlichen Regionen. In der Mitte des Jahrhunderts war die Kohleproduktion im Ruhrgebiet durch den Einsatz der Dampfmaschine und den Bau von Eisenbahnlinien richtig in Gang gekommen, und die Montanindustrie verlagerte sich immer stärker aus Randregionen in die Nähe der Kohlegruben. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts war das Ruhrgebiet das wirtschaftliche Zentrum der gesamten Provinz geworden. Dadurch kamen auch immer mehr Menschen in diese Region, vor allen Dingen aus Süddeutschland und Deutschlands Osten.
Als im Jahre 1871 Kamens erster Schacht abgeteuft wurde, wohnten hier 3723 Menschen. Aber schon 1900 war ihre Zahl auf 9888 gewachsen. Die Zahl der Katholiken war von ca. 400 auf ca. 4500 gewachsen, eine Verelffachung in nur einer Generation! Und ähnlich stellte sich das in ganz Westfalen dar: 1871 lebten 1,78 Millionen Menschen hier, 1900 aber schon 3,2 Millionen.
So entstand in wenigen Jahrzehnten Europas größter Ballungsraum und das industrielle Herz des Kaiserreiches. Was lange Zeit der große Vorteil des Ruhrgebietes war, Bergbau, Eisen– und Stahl– und Textilindustrie, erwies sich seit den 1950er Jahren als Hemmschuh, weil diese sogenannten Altindustrien einen rapiden Niedergang erlebten – auch in Kamen gab es statt Berge– nun Kohlehalden – verschämt „nationale Kohlereserve“ genannt – jedoch die neuen Trägerbranchen des Wirtschaftswunders, Elektro–, Auto– und Chemieindustrie, sich vorwiegend in Süddeutschland befanden. Den Strukturwandel in NRW überstanden mit Abstand am besten die schon aus vorindustrieller Zeit herrührende diversifizierte Eisen–, Draht– und Werkzeugindustrie im Bergischen, Sauer– und Siegerland.
Und weil das Ruhrgebiet lange Zeit durch den Malocher geprägt war, konnte sich auch eine allenfalls rudimentäre bürgerlich-klassische Kultur entwickeln. Die Moderne in Kunst, Literatur, Musik und Architektur war nur schwach vertreten. Die einzige genuine Literaturströmung des Ruhrgebietes war die Gruppe „Literatur der Arbeitswelt“ mit ihrem prominentesten Vertreter Max von der Grün, der auch noch aus Franken zugezogen war. Wo es hervorragende Vertreter dieser Richtungen gab, gründeten sie doch keine Schulen, zogen aus dem Ruhrgebiet weg. Und ein zweiter Standortnachteil war das Fehlen von Universitäten und Fachhochschulen im Ruhrgebiet, die erst in den 1960er Jahren gegründet wurden, dann aber mit Macht und in großer Zahl, und die den notwendig gewordenen Strukturwandel anschoben, begleiteten und beschleunigten.



Ruhrgebiet & Münsterland & Sauerland
Und die ländlichen Regionen im Münsterland, im östlichen Sauerland und im Paderborner Raum erlebten vielfältige Gründungen inhabergeführter Kunststoff–, Chemie–, Möbel–, Elektro–, Maschinenbau– und Entsorgungsindustrien. Der ländliche Kreis Coesfeld ist z.B. die Region mit der niedrigsten Arbeitslosenquote in NRW. So wird sich wohl eine allmähliche Angleichung der Lebensumstände zwischen industriellen und ländlichen Regionen entwickeln.
Aufgrund der industriellen Entwicklung des Ruhrgebiets – jede Stadt mit eigener Zeche, Stahlwerk etc. – entwickelte sich ein Kirchturmdenken, das bis heute anhält und das gemeinsame Vorgehen aller Ruhrgebietsstädte zum gemeinsamen Wohl verhindert, auch wenn es in letzter Zeit nach dem Entstehen einer eigenen sozialen und politischen Trägerschicht mit regionalem Bewußtsein wiederholt Bestrebungen gegeben hat, eine gemeinsame Verwaltung zu etablieren, sei es die zum Kulturhauptstadtjahr Ruhr 2010 besonders lautstark propagierte  oder der Regionalverband Ruhr (rvr), der nach schon jahrelang
oder der Regionalverband Ruhr (rvr), der nach schon jahrelang

verfolgten Plänen als „Ruhrparlament“ von der Bevölkerung direkt gewählt werden soll, was ständig neue Diskussionen provoziert. Und auch wenn frühere Landesregierungen mit dem Slogan „Wir in NRW“ warben – ein richtiges NRW-Bewußtsein will sich nicht einstellen, zu stark ist immer noch die Rivalität zwischen Westfalen und dem Rheinland. Immer fühlt Westfalen sich gegenüber dem Rheinland benachteiligt: dort gibt es mehr Forschungsein-richtungen, wichtigere Institutionen, mehr Kulturförderung durch das Land usw. Und sicherlich liegt es immer noch daran, daß die industrialisierte Ruhr, früher im Bild dargestellt durch die Silhouetten von Zechen und Hochöfen und symbolisiert durch „Kumpel Anton“, heute durch den von Jürgen von Manger erfundenen Ruhrgebietsdialekt, und das ländliche Münsterland, seit Jahrhunderten durch den Kiepenkerl, Schinken und Pumpernickel repräsentiert, nur schwer gemeinsame Interessen haben können. Und ganz eigenständige Identitäten haben Ostwestfalen-Lippe, das Paderborner Land, Sauer– und Siegerland entwickelt.
Es ist noch unklar, wohin NRW, wohin Westfalen sich entwickeln wird, ob die eigenständigen Identitäten der Landesteile ein echtes Zusammenwachsen verhindern werden, ob zwischen Westfalen und dem Rheinland mit einem politisch und verwaltungstechnisch vereinigten Ruhrgebiet etwas Eigenständiges entstehen wird, oder ob tatsächlich das von vielen ersehnte Wir-Gefühl entstehen wird. Wie auch immer die Entwicklung verlaufen wird, die regionalen Besonderheiten jedes Landesteils werden für zumindest regionale Identitäten sorgen. Westfalen bleibt auf jeden Fall Westfalen.
Bildnachweis:
Wikipedia: Nr. 1 / 4 / 5 / 7a
histoire-image: 6
fotocommunity: 9
Presseamt Willingen: 10
KH














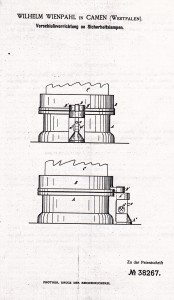




















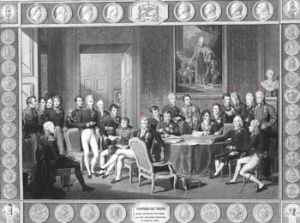






 oder der Regionalverband Ruhr (rvr), der nach schon jahrelang
oder der Regionalverband Ruhr (rvr), der nach schon jahrelang



