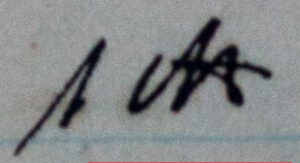von Klaus Holzer
Teil I: Leben in Kamen
Die Anfänge – Historisches
Am Anfang gab es zwei Arten von Kamenern, Bürger und bloße Einwohner, auch Beisassen genannt, meist Tagelöhner. Erstere hatten Eigentum und das Bürgerrecht und waren Handwerker und Ackerbürger. Nicht jeder konnte Bürger sein: er mußte eine Gebühr von 2 – 5 Talern an die Stadt bezahlen, je nach Vermögen; er mußte ein Handwerk ausüben, das seine Familie ernähren konnte; er mußte Steuern und Abgaben bezahlen; er mußte sein Teil zur Verteidigung der Stadt beitragen; er mußte einen ledernen Eimer bei der Feuerwache im Rathaus abgeben und bei (den damals häufigen) Bränden beim Löschen kräftig mithelfen; er mußte, und das war besonders wichtig, den Bürgereid leisten.
Exkurs 1: Ich zitiere diesen Eid hier vollständig, weil er bezeichnend ist für die Verpflichtung, die der Bürger im MA im Verhältnis zu seiner Stadt, seiner Heimat, einging, wie das private Wohlergehen mit dem Gemeinwohl verbunden war:
„Ich, … gelobe und schwöre einen Eid zu Gott, daß ich Seiner Kurfürstlichen Durch- laucht, Herrn … Kurfürsten von Brandenburg (Anm: Dieser Wortlaut galt also zwischen 1609 = Kamen wird brandenburgisch und 1701 = Brandenburg wird Preußen) usw., auch Herren Bürgermeistern und Rat dieser Stadt in allen Sachen treu und hold, auch gehorsam sein, ihr Gebot und Verbot nicht verachten, Ihrer Kurfürstlichen Durchlaucht dem Herrn usw. und dieser Stadt Bestes mit äußerstem Vermögen vorstellen, das Aergste und Widerwärtige abwenden und verhüten helfen, und da ich etwas hören oder vernehmen würde, daß hochgemeldeter Ihrer Kurfürstlichen Durchlaucht ins Haupt, auch Bürgermeistern und Rat hierselbst, und gemeiner Stadt zur Verkleinerung oder nachteiligen Part gereichen thäte, dasselbe nicht verschweigen, sondern an behörenden Orten anbringen; da ich aber zu anderen dergleichen Zusammenkünften gefordert, daselbsten zu keiner Unruhe, sondern zu allem friedfertigen Wesen, Ursach und Anlaß geben; mit Hintansetzung aller Privat- und eigennützigen Affekten, einzig und allein dasselbe, was zu gemeiner Stadt Nutzen und Besten gedeihen mag, beratschlagen und vorstellen helfen; der Stadt Rechten, Gewohnheiten, Privilegien und guten Ordnungen nicht widerstreben; – und sonsten, was einem ehrlichen, gehorsamen und getreuen Bürger wohl anstehet und gebühret, und im Gewissen vor Gott, wie dann hoher Landesfürstlicher und dieser Stadt Obrigkeit und männiglichen zu Ehren, jederzeit verantwortlich, thun und handeln solle und wolle, so gewiß mir Gott hilft und sein heiliges Wort durch Jesum Christum!“ (Zit. aus Fr. Buschmann, Geschichte der Stadt Camen, 1841) Kurz: Er mußte immer zum Wohle des Gemeinwesens wirken. (Anm.: Luthers Bibelübersetzung und ihre entscheidende Rolle zur Entwicklung eines klaren und kräftigen Deutsch ist hier offenbar noch nicht angekommen!)
„Einwohner“ waren in der Regel Tagelöhner, die in allen Belangen schlechter gestellt waren. Sie hatten nur selten Geld, und wenn doch, nur wenige Pfennige, waren meist auf minderwertige Waren angewiesen, z.B. Fleisch vom Abdecker. Sie hatten kein regelmäßiges Einkommen, wohnten in einer winzigen Kammer zur Miete, die nicht in bar entrichtet, sondern durch Handarbeit abgegolten wurde. Sie mußten an Arbeit erledigen, was gerade anfiel, eine Wahl hatten sie nicht. Wirklich beliebt waren sie nur zur Erntezeit, da wurde jede Hand gebraucht, damit die Ernte, z.B. zwischen zwei Schlechtwetterperioden, rechtzeitig eingebracht werden konnte.
Ackerbürger konnten für sich selber sorgen, kauften auf den Märkten nur zu, was sie selber nicht produzieren bzw. bei ihren Nachbarn, den Handwerkern in ihrer Stadt, nicht kaufen konnten, meist am Markttag bei den Händlern auf dem Markt. Hier gab es so gut wie alles, nicht nur landwirtschaftliche Produkte. Besondere Kleiderstoffe wie Brokat, Damast, Samt, Seide, Schmuck, vielleicht auch schon einmal ein Flugblatt (wie z.B. Luther und Dürer sie produzierten), Papier, Litzen, Bänder u.ä. Die wertvollen Waren wurden aber nicht unter freiem Himmel auf dem Marktplatz verkauft, sondern im großen Ratssaal, dort waren sie sicherer und lagerten trocken.
Der Alltag der Menschen im MA wurde durch das kirchliche Jahr bestimmt, besonders regelmäßig wiederkehrende Ereignisse wie Jahr- und Wochenmärkte bzw. Kirmessen wurden an den Tagen bestimmter Heiliger veranstaltet:
„Die jährliche Abhaltung von 2 Jahrmärkten, am Sonntage nach Mariae Geburt und am Sonntage Judica. Jetzt hat die Stadt alljährlich drei Krammärkte. Von diesen Jahrmarktstagen fällt der erste auf den Ostermontag, der zweite auf den Sonntag nach St. Vitus, dem 15. Tage des Monats Juni, und der dritte auf den Sonntag vor Simon und Judae, den 28. October.“ (Friedrich Buschmann, Geschichte der Stadt Camen, 1841)
Und Pröbsting ergänzt: „Durch eine andere vorliegende Urkunde vom Jahre 1432, octava St. Martini epist. verlieh der Graf Eberhard von Cleve, Graf tor Marke, der Stadt Camen zu ihren alten Kirmessen noch zwei weitere und zwar eine auf den nächsten Sonntag nach Mariae nativitatis, wo das Kirchweihfest des Hospitals zu Camen gefeiert wird, und eine zweite auf den nächsten Sonntag nach Mittfasten gen. Judica. Die neuen Kirmessen sollen dieselben Rechte haben, wie die alten.“ (Friedrich Pröbsting, Geschichte der Stadt Camen und der Kirchspielsgemeinden von Camen, 1901)
Dieselben Rechte wie die alten, d.h., „… und zwar in der Weise, daß niemand an diesem und den drei unmittelbar vorangehenden und folgenden Tagen wegen einer Schuld ohne Verfehlung verpflichtet oder gepfändet werden darf, sogar nicht, wenn er gesetzlos oder geächtet sein sollte.“ (Zit. aus: „Dokumente aus der Geschichte der Stadt Kamen, Hrsg. Stadt Kamen, Stadtarchiv, Kamen 1984, Blatt 3b) Es werden hier zwei Dinge deutlich: Erstens ist die Stadt Camen in mancherlei Hinsicht privilegiert, zweitens wird die Bedeutung von Märkten zu der damaligen Zeit klar. Ein Markttag war mehr als nur ein Einkaufstag, zumal ja auch, wenigstens bei den Jahrmärkten, immer auch Gaukler, Schauspieler und anderes fahrendes Volk anwesend waren und für hochwillkommene Unterhaltung sorgten.
Abb. 1: Passage an der Nordstraße: Die typische Wohnform in der Ackerbürgerstadt
Es war schon von Tagelöhnern die Rede, Knechte und Mägde gehörten ebenfalls zur untersten Klasse. Diese wurden nicht das ganze Jahr über beschäftigt, sondern nur saisonal. Knechte und Mägde traten üblicherweise in den Dienst ihrer bäuerlichen Herrschaften an St. Georgi, dem 23. (mancherorts dem 24.) April. An diesem Tag zogen auch Hirten und Schäfer mit ihren Tieren auf die Sommerweide. In den Alpen gibt es das noch heute, nur finden Almauf- und -abtrieb später im Frühjahr und früher im Herbst statt, da die Winter bedeutend länger sind. (Ob zu erwartende klimatische Veränderungen auch diese Tradition beenden werden?)
Abb. 2: Passage an der Ostenmauer: desgl.
Das bäuerliche Wirtschaftsjahr endete für gewöhnlich an Martini, dem 11. November. Dann wurden die Dienstboten entlohnt und alle anderen Zahlungen wie Steuern und Lohn fällig, Pachtverträge wurden abgeschlossen, beendet oder erneuert. Darauf ist auch der Brauch der Martinsgans zurückzuführen. Dieses Datum markiert den Beginn der Schlachtsaison. Jetzt wurde alles Vieh geschlachtet, dessen Fleisch man für die Winterverpflegung brauchte: es wurde getrocknet oder geräuchert (westfälischer Knochenschinken!), eingesalzen, eingekocht.
Abb. 3: Westfälischer Knochenschinken
Daneben war der Martinstag auch der traditionelle Tag des Zehnten. Die Steuern wurden früher in Naturalien bezahlt, auch in Gänsen, da die bevorstehende Winterzeit das Durchfüttern der Tiere nur in einer eingeschränkten Zahl möglich machte. An diesem Tag begannen und endeten auch Dienstverhältnisse, Pacht-, Zins- und Besoldungsfristen. Landpachtverträge beziehen sich auch heute noch häufig auf „Martini“ (kurz für: Festum Sancti Martini = das Fest des Hl. Martin) als Anfangs- und Endtermin, da der Zeitpunkt dem Anfang und Ende der natürlichen Bewirtschaftungsperiode entspricht. Der Martinstag wurde auch Zinstag genannt.
Abb. 4: Martinsgans
Die verschiedenen Bräuche wurzeln in zwei wohl zusammenhängenden Umständen, dem Ende des landwirtschaftlichen Wirtschaftsjahres und dem Beginn einer 40-tägigen Fastenzeit. In der von Byzanz beeinflussten Christenheit lag der Martinstag zunächst am Beginn der vierzigtägigen Fastenzeit ab dem 11. November, die vom Mittelalter bis in die Neuzeit hinein – in den orthodoxen Kirchen teilweise bis heute – vor Weihnachten begangen wurde. Am letzten Tag vor Beginn dieser Fastenzeit konnten die Menschen – analog zur Fastnacht – noch einmal schlemmen. So wird noch heute beim rheinischen Karneval die neue Session am 11. November ausgerufen.
Die frühe Moderne
Abb. 5: Zechenhäuser im Schulzhof/Galenhof
Geschäfte, wie sie uns heute geläufig sind, gab es nicht. Der Ackerbürger und der Handwerker sorgten für sich selber. Die oft kinderreichen Familien der Tagelöhner hatten meist kaum Geld, um Vorräte anzulegen. Sie lebten von der Hand in den Mund. Geschäfte entstanden erst mit dem Beginn der Industrialisierung, als es den Industriearbeiter gab. Für diese Familien wurden seit Mitte des 19. Jh. sogenannte Konsumgenossenschaften gegründet, die alles für den täglichen Bedarf anboten, meist zu subventionierten Preisen.
In Kamen begann die Neuzeit mit dem Beginn des Betriebs der Köln-Mindener Eisenbahn im Mai 1847 und, vor allem, dem Einzug des Bergbaus 1873. Erst jetzt gab es Mietwohnungen in nennenswerter Zahl, die aber meist so klein waren, daß man keine Vorräte in ihnen lagern konnte, und Gärten zu den Mietwohnungen gab es erst später. Und so eng die Wohnungen auch waren (Ernst Beyer gibt darüber beredte Auskunft in „… der kommt doch aus den Zechenhäusern. 100 Jahre Wohnen und Leben in Zechensiedlungen“ (1888 – 1988) Bochum 2001): wenn es nur irgendwie ging, nahm man auch noch Kostgänger auf, d.h. alleinstehende Männer, die das während der Schicht des Hausherrn freie Bett mieteten und auch mitessen durften. Gegen Bezahlung, versteht sich. Dabei wurde unterschieden nach: „halbe Kost“ = Morgenkaffee und Mittagessen (alles andere mußte man sich selber kaufen), „volle Kost“ (deckte alle Kosten ab) und „volle Kost voll“ (es war alles inbegriffen, auch die Kostmutter). Und wenn es in einer Wohnung mehr Platz gab, weil z.B. Familienmitglieder ausgezogen waren, dann konnten zwei Kostgänger aufgenommen werden, sofern einer in der Nachtschicht, der andere in der Tagschicht arbeitete. Man teilte sich ein Bett.
Abb. 6: Bewohner vor einem Zechenhaus im Schulzhof/Galenhof
Wenig romantisch sieht das August Siegler in der Zechenzeitung 1926: „In schneller Reihenfolge entstanden nun in Kamen die großen Koloniebauten. Die Zechenverwaltung erwarb 1888 das schöne Besitztum des Barons von Vogel und den Rungenhof und 1897 den Schulzhof (Anm: heute Galenhof genannt). Gleich nach dem Erwerb dieser Grundstücke wurde mit dem Bau der großen Koloniehäuser an der Kampstraße, Nordenmauer und Nordstraße begonnen. Drei dieser Häuser haben für je 12 Familien nur einen Eingang von der Straße aus und einen Ausgang zum Hof. Man kann nicht sagen, daß eine solche Bauweise dazu dient, die Gemütlichkeit und den häuslichen Frieden zu fördern.“ Und er erkennt noch etwas: „Durch den Bau dieser Häuser fielen leider schöne Grünflächen in der Stadt fort.“
August Siegler war damals einer der wenigen, vielleicht sogar der einzige, der auch, weiterblickend, die städtebaulichen und sozialen Folgen erkannte. „Die Kampstraße war damals von der Rottstraße (Anm.: heute Adenauerstraße) bis zur Nordenmauer sehr schmal. An der Ecke der Rott- und Kampstraße, wo sich jetzt die Metzgerei befindet (Anm.: wohl Pferdemetzger Weber), war ein Teich. Gegenüber lag im Baumhof der von Vogelschen Besitzung auch ein solcher. An der Nordenmauer stand eine große alte Scheune mit Wohnung. An der Nordstraße befanden sich von Mauern umgebene Gärten. Zwischen diesen lag hinter dem größeren Eingangstor der gepflasterte Weg zum Hauptgebäude. Die Stadtväter waren zu ängstlich, dieses schöne Grundstück, das zu einem niedrigen Preise zu erwerben war, zu übernehmen. Auch war damals die Einstellung mancher Kreise hinderlich, solche Gelegenheiten wahrzunehmen. Die Konkurrenzfurcht ließ sie nicht ruhen, dahingehende Pläne zu bekämpfen. Privatleute hatten aber erst recht keinen Mut, die billigen Grundstücke zu erwerben. Der Zechenverwaltung konnte man daraus keinen Vorwurf machen, daß sie die ihr angebotenen Grundstücke erwarb.“
Der Kauf der Burgmannshäuser (Galen-/Schulz-, Vogel- & Rungenhof) mitsamt großen Grundstücken durch den Bergbau führte zum Bau von billigen Mietwohnungen, die die städtische Siedlungsstruktur dramatisch veränderten. Sie wurden allesamt nach 1960 abgerissen: für modernere Wohnbebauung (Schulz–), Einkaufszentrum (Vogel–), Gymnasium mit Grünfläche (Rungen–), und die großen Freiflächen in der Stadtmitte, auf denen Kirmes und Zirkus Platz fanden, verschwanden.
Durch den Bau von Mietwohnungen durch die Bergwerksgesellschaften wurden Bergleute angelockt und in jeder Hinsicht an die Zechen gebunden, die ihre Arbeiter ja zu Beginn überhaupt erst in die Stadt geholt hatten: wo außer in den Werkswohnungen hätten sie denn in dem kleinen Landstädtchen wohnen sollen? Und wer, außer der Zeche, bot ihnen einen Arbeitsplatz? Es ist deutlich, wie sehr Kamen in kurzer Zeit von der Zeche abhängig wurde. Sie ließ keine Konkurrenz zu, betrieb durch den Ankauf der Burgmannshöfe de facto Stadtplanung und beeinflußte auf diese Weise die Stadtentwicklung nachhaltig.
Solange die Versorgung der neu Zugezogenen vor Ort geschah, bzw. durch die Bauern der umliegenden Dörfer, spielten die Verkehrsverhältnisse kaum eine Rolle (vgl.a. Artikel Maibrücke), mit der Industrialisierung aber entstand ein immer größerer Bedarf, daher wurde Transport notwendig, Verkehrsverbindungen wichtiger, schlechte Straßen machten die Versorgung schwerer. Immer größere Mengen an Lebensmitteln mußten über immer größere Entfernungen herangeschafft werden. Infrastruktur wurde zum entscheidenden Faktor: schlechte Straßen, marode Brücken, fehlende Fahrzeuge, kein Bahnanschluß – nichts funktionierte mehr richtig, auch nicht der Abtransport des Produkts Kohle. (Anm.: Klingelt da was?) Es mußten Straßen und Eisenbahnen gebaut werden, und beides geschah in rasendem Tempo. Wahrscheinlich ging es früher deutlich schneller als heute, wo die Bürokratie überall mitredet und verzögert.
Abb. 7: Bergarbeiterfamilie mit Kostgänger
Erst als der Bergbau sich Mühe geben mußte, neue Arbeiter anzuwerben, damit man expandieren konnte, wurden Kolonien, d.h., Bergarbeitersiedlungen, in größerem Stile gebaut, die alle einen Garten hatten, damit die Bergleute zum einen an die frische Luft kamen (und fit wurden für die Arbeit untertage) und zum anderen Gemüse für den Eigenbedarf anbauen konnten. So konnten die Zechenbarone, nebenbei bemerkt, auch noch Lohngeld sparen. Die ersten Geschäfte bedienten vor allem den Bedarf der Kamener an Lebensmitteln. Und die ersten Läden, die mit vielen Filialen in vielen Städten vertreten waren, tauchten bald auch in Kamen auf: Konsum (viele Einzelgründungen seit 1850, im Ruhrgebiet ab etwa 1890; ruhrgebietstypisch mit Betonung auf der ersten Silbe). Der erste Kamener Konsum, Konsum Nr. 1, befand sich in dem Gebäude neben Kajak, dem denkmalgeschützten Haus Am Geist 6, das im Augenblick (Ende 2023) in einem jämmerlichen Zustand ist. Dieses Gebäude steht an der Stelle, wo früher die zum alten Gasthaus Zum Hirschen gehörige Scheune (heute, ab Dezember 2023, Galerie Arnemann) stand. Daß Haupthaus und Scheune früher einmal eine Einheit bildeten, sieht man an der durch den Abriß verlorengegangenen Symmetrie: Hauseingangstür und Scheunentor bildeten eine gestalterische Einheit. Dann kamen Tengelmann’s Kaffee-Geschäft (gegr. 1867) und Kaiser’s Kaffeegeschäft (gegr. 1881). Kaiser’s Kaffeegeschäft eröffnete zuerst am Markt, neben dem alten Rathaus, danach kam Tengelmann; nach Tengelmanns Weggang kam Seifen-Lethaus, wo man alles bekam, um den Haushalt sauber zu halten. Und das war damals anstrengend genug. Kaiser’s zog dann in das frühere Rundschauhaus, heute (bis Herbst 2023) Galerie Arnemann, an der Ecke Marktplatz/ Am Geist.
Abb. 8: Konsum Nr. 1 (im Hintergrund links)
Abb. 9: Tengelmann’s Kaffeegeschäft (Ecke Markt – Kirchstraße)
Abb. 10: Kaiser’s Kaffeegeschäft (Nordseite des Marktes)
Die Notwendigkeit solcher Geschäfte ergab sich aus der Situation, in der die Bergarbeiter und ihre Familien sich mit Beginn des Bergbaus befanden. Sie kamen der Arbeit wegen ins Ruhrgebiet, fanden sich aber in engen, schlecht ausgestatteten Wohnungen wieder. Es gab keinen Mieterschutz, als Konsumenten häuften sie Schulden über Schulden an. Das Wort „anschreiben“ war wesentlicher Bestandteil ihres Wortschatzes, wenn sie bei den ortsansässigen Krämern einkauften. Was gleichbedeutend war mit einem Kredit, dessen Höhe man kaum kontrollieren konnte. Erst wenn wieder eine Lohntüte gekommen war, konnte man einen Teil seiner Schulden abtragen. Damit das Geld auch tatsächlich zu Hause ankam, wartete manche Frau am Zahltag vor dem Zechentor auf ihren Mann und nahm ihm den Lohn ab, damit er nicht in der in Kamen immer nahen Kneipe in Bier und Korn umgesetzt wurde. Das war zu einer Zeit ohne Tarifbindung und Kündigungsschutz, aber mit „Nullung“ (wenn Berge, d.h. taubes Gestein, zwischen den Kohlebrocken von Kontrolleuren gefunden wurde, wurde der Wagen genullt, d.h. nicht angerechnet) im Bergbau. Hier waren die Konsumgenossenschaften mit ihrem Gemeinschaftsprinzip die rettende Idee.
Abb. 11: Haus Markus (Ostseite des Marktes)
Aber es gab auch ganz besondere Geschäfte. Ein solches war das Geschäft für Aussteuer- und Hochzeitsausstattungen der Familie Markus Markt 10 (dieser Familie entstammte der bekannteste und bedeutendste deutsche kantische Philosoph zu Beginn des 20. Jh., Ernst Moses Markus, 1856 – 1928). Die meisten jungen Leute werden heute nicht mehr wissen, was eine Aussteuer ist. Bis zum II. Weltkrieg aber war sie ein unabdingbares Muß für alle bürgerlichen (und bäuerlichen) Familien: eine Braut aus gutem Hause brauchte eine Mitgift. Die brachte sie mit in die Ehe ein, während die Söhne eher eine gute Ausbildung bekamen. Solch eine Mitgift umfaßte alles, was der neue Hausstand benötigte: Federbetten, Leinen (die Leineweberei war neben der Schuhmacherei in Kamen jahrhundertelang der Haupt-Handwerkszweig), Stoffe aus Baumwolle und Damast, aus denen dann die benötigte Wäsche wie Bett-, Tischwäsche und Handtücher genäht werden konnte. Und es war der Stolz der jungen Frau, daß alle ihre Tücher und Laken ein handgesticktes Monogramm trugen. Und auf den Tüchern, hinter denen man die Hand- und Trockentücher in der Küche verbarg, stand auch immer ein weiser Spruch, z.B.:
Der Frauen edelster Beruf,
Zu dem sie Gott der Herr erschuf,
ist, in dem Hause still zu walten
Und Fleiß und Ordnung zu erhalten.
Für die Mitgift gab es extra Schränke bzw. Truhen, in denen dieser Schatz aufbewahrt wurde. Die Truhen hatten einen gewölbten Deckel, damit die oben liegenden Stoffballen, die ja für die Verarbeitung ständig griffbereit sein mußten, Platz genug hatten. Darinnen wurde auch das Taufkleidchen aufbewahrt, für Jungen und Mädchen dasselbe, nur eine angeheftete blaue oder rosa Schleife bezeugte, um wen es sich bei der Taufe handelte.
Wer genug Geld hatte, bestellte und bezahlte Näherinnen und Stickerinnen, die das übernahmen. Aber wenn die Nachbarn in der kleinen Stadt das mitbekamen, dann warf das ein schlechtes Licht auf die Braut, die sollte das schon selber können und machen. Und kein Haushalt konnte ohne Töpfe, Pfannen, Kessel, Waschwannen, Geschirr und Besteck funktionieren.
Abb. 12: Aussteuerschrank für die Mitgift
Abb. 13: Truhe für die Mitgift
Alles das bot Markus an. Aber natürlich geht man nicht in so ein Geschäft, stellt sich an die Verkaufstheke und sucht ein paar Minuten lang aus, was man braucht. Das war die Unternehmung eines ganzen Tages. Die Kunden wurden im Kontor mit Kaffee bewirtet und bekamen Muster vorgelegt. Meist kam die ganze Familie mit, auf jeden Fall die Mutter und alle Schwestern der Braut, einen so aufregenden Tag wollte sich keine entgehen lassen. Wieviel prosaischer ist der heute so oft geübte Brauch, allen zur Hochzeitsfeier geladenen Gästen die Adresse des Geschäfts zukommen zu lassen, in dem ein Mustertisch gedeckt ist, auf dem alles, was des Brautpaars Herz begehrt, auf- und ausgestellt ist, mit Preisangabe. Dort darf der zukünftige Gast dann aussuchen, was er zu schenken gedenkt. Praktischerweise steht der Preis überall dran, und alles schon Georderte ist als solches gekennzeichnet. Es lohnt sich also, schnell zu sein, sonst ist nur noch Teures zu erstehen.
Dieses änderte sich nach dem I. Weltkrieg, als selbst vorher wohlhabende Familien sich keine Aussteuer mehr leisten konnten, weil die Inflation alles Vermögen aufgefressen hatte. Jetzt folgten die Töchter den Söhnen und lernten Berufe oder „gingen in Stellung“, d.h., als Hilfen und Lehrlinge in den Haushalt von Familien, die sich das immer noch leisten konnten. So verdienten sie sich das Geld für ihre Aussteuer selber.
Und noch etwas hatte sich geändert. Zu den Geschäften, die alles für den täglichen Bedarf anboten, waren auch solche hinzugekommen, die alles fertig anboten: niemand mußte mehr seine Wäsche nähen, man konnte sie im Laden fertig kaufen. Und nicht wenige Geschäfte boten auch Monogramm-Stickereien an, entsprechend war das Lernen von Stricken, Sticken und Nähen nicht mehr überall verbreitet.
Abb. 14: Ein Kolonialwarenladen: Der Tante-Emma-Laden im Stadtmuseum Bergkamen
Und es war eine weitere Art von Geschäft hinzugekommen. Deutschland hatte in der zweiten Hälfte des 19. Jh. den Ehrgeiz, mit Ländern wie England und Frankreich mitzuhalten, d.h., es wollte auch Kolonialmacht sein. Das war zwar, aufs ganze gesehen, keine gute Idee, aber so kam eine Reihe ganz neuer Produkte in die deutschen Läden. Reis, Zimt, Kaffee, Kakao, Tee und Gewürze, das, was man Kolonialwaren nannte. Das vorherige Angebot von Getreide, Buchweizen, Kartoffeln (die es seit 1795 in Westfalen gab, in unserer Region zuerst auf Haus Velmede der Bodelschwinghs angebaut) wurde also beträchtlich und mit interessanten Neuheiten bereichert.
Und wieder erkannte ein Kamener seine Chance und nutzte sein um 1812 erbautes Haus Markt 2 als Kolonialwarengeschäft, der Ökonom und Kaufmann Matthias Syberberg. Sein Erfolg kam u.a. daher, daß er eine erstklassige Lage besaß, an der Ecke Bahnhofstraße – Markt, direkt gegenüber dem Rathaus. Schon vorher hatte er gute Geschäfte gemacht, weil er alles das anbot, was man außer Lebensmitteln noch für den Haushalt brauchte: Salz, Soda und Pottasche (fürs Wäschewaschen), Seife, Petroleum, Holzschuhe. Seine Kunden kamen aus allen Dörfern rund um Kamen, besonders an Markttagen war immer viel los in der Stadt. Ab 1873 führte sein Sohn Wilhelm Syberberg das Geschäft, starb aber bereits kurz darauf. 1874 heiratete seine Witwe den Kolonialwarenhändler Wilhelm Mertin und die beiden führten das Geschäft weiter.
Abb. 15: Wilhelm Mertin (Haus am rechten Rand)
Das Haus steht heute noch, sieht aber ganz anders aus als damals. Früher war es ein typisch westfälisches Fachwerkhaus mit klarem, einfachem Fachwerk, hatte dunkelbraune Balken, weiße Gefache und grüne Läden. Aber Mertin wollte mit der Zeit gehen und ließ 1874 das Fachwerkhaus verputzen, Neoklassizismus war der Stil der Zeit. Wir sind schließlich im neuen deutschen Kaiserreich, der Krieg gegen Frankreich war gerade gewonnen worden und zur Erinnerung an die entscheidende Schlacht in diesem Kriege hatten die Kamener Bürger gesammelt und das eindrucksvolle Sedandenkmal mitten auf den Marktplatz gestellt. Man platzte vor Selbstbewußtsein. Wer wollte nicht in der Moderne dabei sein? Der Anschluß Kamens an die Köln-Mindener Eisenbahn 1847 erzeugte einen Entwicklungsschub, wie die vielen denkmalgeschützten Häuser in der Bahnhofstraße bezeugen. Aus dem ehemaligen Ackerbürgerhaus Mertin mit angebauter Scheune wurde jetzt ein recht repräsentatives städtisches Haus. Die Scheune paßte nicht dazu, sie wurde in ein Porzellanlager mit Verleih um- und ausgebaut.
Und das lohnte sich, waren doch die westfälischen Bauernhochzeiten immer üppige, ausufernde Feste. So üppig, daß Familien sich nicht selten verschuldeten, weswegen das nüchtern-sparsame Preußen, zu dem Kamen seit 1815 gehörte, strenge Gesetze gegen diese Völlerei erließ, aber die westfälischen Sturköppe in der Provinz scherten sich keinen Deut darum. Die Hochzeitsbitter kamen noch lange nicht aus der Mode. Das waren Leute, die herumgingen und zur Feier einluden, oft auf humorig-derbe Art und Weise. Die Feiern fanden i.d.R. in der Scheune oder auf der Deele statt, doch wer hatte schon genug Geschirr und Besteck für 100 Leute? Da kam Wilhelm Mertin ins Spiel, er hatte, lieferte und holte wieder ab. Und fürs Kochen heuerte der Gastgeber Kochfrauen an, meist arme Witwen aus der Nachbarschaft, die dafür einmal auch ein gutes Essen und ein wenig Geld bekamen.
Der Kamener Stadtchronist Friedrich Pröbsting schreibt in seinen „Erinnerungen“ 1902/03: „Auch bei den Hochzeiten wurden manchmal große Gesellschaften zu Gast geladen, und ein solches Hochzeitsfest war ein Ereignis für das ganze Dorf. War es eine Mittagshochzeit, so wurde sie vom alten Lehrer Schmidt in 2 Kategorien geteilt; entweder war es eine Reishochzeit, dann gab es Reisbrei, Butterbrod und Kuchen; oder es war eine Bratenhochzeit, dann gab es mehrere Gänge Fleischspeisen, Braten und Kuchen. Nach dem Essen gingen dann die Gäste zu den Nachbarn im ganzen Dorf von Haus zu Haus und tranken dort Kaffee, viele Tassen; denn es galt für eine Ehrenpflicht, an keinem Hause vorüberzugehen, ohne dort ein „Köppchen“ zu trinken.“
Für uns ist klar: die Bratenhochzeit war gesellschaftlich angesehener, weil üppiger. Doch das war damals anders, und hier kommt der Kolonialwarenhändler wieder ins Spiel. „Braten“ hatte jeder Bauer reichlich, Schwein, Kalb, doch Reis, Zimt und Kaffee waren Kolonialwaren, die teuer gekauft werden mußten, sie waren der wahre Luxus.
Wilhelm Mertin hatte also eine bevorzugte Lage für sein Geschäft, doch forderte die Moderne auch von ihm Tribut. Die Industrialisierung Kamens brachte die Notwendigkeit eines ÖPNV mit sich, der damals einfach Straßenbahn hieß: die Arbeiter mußten zur Zeche und in die Fabriken kommen, die Bürger hatten immer mehr Gänge zum Amt, alles zu Fuß zu erledigen wie früher, kostete nun zu viel Zeit. Ab September 1909 fuhr die Straßenbahn zunächst von Unna nach Kamen, ab 1911 weiter nach Werne. Daher hieß sie Kleinbahn UKW (Unna – Kamen – Werne). Sie war von Anfang an elektrisch, im Zeitalter der Dampfloks! Sie fuhr diagonal über den Markt, und genau an der Ecke Rathaus – Mertin war die Bahnhofstraße so eng, daß kein Begegnungsverkehr möglich war.
Kam aber einmal ein Pferdefuhrwerk oder, selten, ein Auto zeitgleich mit der Straßenbahn an diese Stelle, wurde es für Fußgänger lebensgefährlich. Um diese Stelle zu entschärfen, entschloß sich die Stadt Kamen, die Arkaden als Fußgängerpassage einzubauen. Dazu wurde nur der Eingang ein paar Meter nach innen versetzt, und alles war wunderbar.
Abb. 16: Die Rathausapotheke, seit 1928 mit Arkaden und mit Elementen der Weserrenaissance verziert
Außer für Louis Mertin, der den Laden inzwischen betrieb. Der sah, daß nun die andere Straßenseite die Laufseite geworden war, kein Kunde mehr „seine“ Seite benutzte, daß er vom Kundenstrom abgeschnitten war. Was umso schlimmer war, als es mittlerweile reichlich viele Lebensmittel- und Kolonialwarengeschäfte als Konkurrenz gab. Also baute auch er um. 1928 legte er das Fachwerk wieder frei und baute entlang der Bahnhofstraße ebenfalls Arkaden ein. Zusätzlich ließ er sein Haus im Stile der Weserrenaissance schmücken (wie z.B. in Hameln und Höxter), was zwar unwestfälisch aber sehr dekorativ ist. Diesen „fremden“ Einfluß sicherte er durch einen Segensspruch ab: „HUS UND HANNEL GOUT ANVERTRAUT BRENGT GLÜCK UN SIÄGEN STÜRT DE NAUT.“ (Haus und Handel Gott anvertraut bringt Glück und Segen und stört die Not)
Im II. Weltkrieg fiel der einzige Sohn der Mertins, es gab keinen Nachfolger für das Geschäft. Die alte Frau Mertin betrieb es noch ein paar Jahre, versuchte, mit einem breiten Warenangebot ihren Laden zu halten, immer wieder einmal hatte sie einen wassergefüllten Zinkeimer unter den Arkaden vor dem Laden stehen, in dem ein lebender Fisch schwamm, aber alles half nichts, 1957 zog die Apotheke Blume hier ein. Aber noch Jahre später kamen immer wieder einmal Bäuerinnen aus dem Umland und wollten Porzellan ausleihen. Das gab’s nimmer, Bauernhochzeiten jedoch immer noch.
Nach dem Kriege
Wer heute einkaufen geht, steuert zumeist einen einzigen Laden an, in dem er alles findet, was er sucht: Lebensmittel, Fleisch, Putzmittel, Schreibwaren usw. Viele fahren dafür einmal die Woche zum Supermarkt auf die „grüne Wiese“, laden den Kofferraum voll und sind für eine Woche versorgt. Die Gutachten, die damals diese Supermärkte als „unschädlich für die Innenstadt“ klassifizierten, waren der erste große Sargnagel für die Innenstädte, nicht mehr rückgängig zu machen. Der zweite wohl die Flächensanierung – was für ein Euphemismus! – ganzer Stadtteile, in Kamen der Nordstadt zugunsten der Ansiedlung von Karstadt im Stadtzentrum, das nach nur wenigen Jahrzehnten wieder schloß. Beides sorgt für nachhaltigen Leerstand in Innenstädten. Und heute natürlich noch der Internethandel, der aber immerhin viel Zustellverkehr in die Innenstadt bringt, auch eine Art von Belebung.
Abb. 17: Erst Karstadt, dann Hertie
Die alten Kamener werden sich aber wohl noch erinnern, wie das nach dem Krieg war, in den späten 1940er und 1950er Jahren. Zwar gab es bereits seit längerem den Konsum, Kaiser’s Kaffeegeschäft und Tengelmann, die mit einem breiteren Angebot aufwarteten, doch der Normalfall, die vielen kleinen inhabergeführten Geschäfte, sah anders aus. Und den Wocheneinkauf auf der „grünen Wiese“ zu erledigen, schied schon deswegen aus, weil es dort wirklich nur grüne Wiese gab und weil kaum jemand ein Auto besaß. Wie also war es damals?
Viele kleine Lebensmittel- und Kolonialwarenhändler boten ihre Waren an, so viele, daß sie hier nicht alle aufgezählt werden können. Hier nur wenige bekannte Namen (daß diese Auswahl nicht vollständig sein kann, liegt auf der Hand): Henter und Blankenstein in der Bahnhofstraße, Sirringhaus in der West- und der Hammer Straße, bei denen es natürlich keine heute selbstverständliche Selbstbedienung gab. Es gab ja noch keine Maschinen, die Zucker, Mehl u.a. automatisch abfüllen und verpacken konnten, eine unabdingbare Voraussetzung dafür. Robert Blankenstein und seine Frau z.B. steckten eine Tüte in eine Ringhalterung an der analogen Waage und wogen alles fein säuberlich ab, aufs Gramm genau. Ein paar Gramm mehr oder weniger in den Preis umzurechnen, wäre sehr aufwendig gewesen, ohne Taschenrechner. Die Ware wurde mittels einer kleinen Schaufel aus großen Schubläden an der Rückwand geholt. Digitale Waagen, die heute jedes Gramm zuviel oder zu wenig sofort genau in den Preis umrechnen, gab es nicht. Auf der Theke standen große Bonbongläser mit z.B. Himbeerklümpchen, das damalige Pendant zur heutigen Quengelzone.
Für Fleisch und Wurst steuerte man eine Metzgerei an, z.B. Radtke in der Bahnhofstraße, Ebbinghaus in der Weststraße, Kusat in der Schulstraße, aber natürlich gab es noch viele mehr. Die Wurst wurde nicht von Fabriken andernorts zugeliefert, sondern in der eigenen Wurstküche hergestellt: ff Fleisch- und Wurstwaren. Und man kaufte nicht soundsoviel Gramm, sondern ein viertel, halbes, ganzes Pfund. Das Zeichen, das man schrieb, sah so aus:
Abb. 18: Das Zeichen für „Pfund“
Exkurs:
ff bedeutete „feinste Fleisch- und Wurstwaren“, wurde aber auch im Lebensmittelhandel ganz allgemein verwendet, z.B. „ff Speiseöl“. Ganz klar ist der Ursprung dieses Ausdrucks nicht. Er entstammt wahrscheinlich dem Italienischen: f = fino, ff – finissimo. Im übertragenen Sinne beherrscht man etwas „aus dem Effeff“. Diese Bedeutung leitet sich vermutlich aus der alten Abkürzung für die Gesetzessammlungen des römischen Rechts, den Digesten, her. ff entstand wohl aus entstellt aus einem, durchstrichenen D.
Abb. 19: Rumpsteak
Wenigstens in der Erinnerung schmeckt diese Wurst viel besser als alles, was man heute bekommt, etwa Radtkes Saure Rolle im pelzigen Darm. Das Fleisch von damals läßt sich mit dem von heute nicht vergleichen. Alles Fleisch heute ist praktisch fettfrei, selbst ein Rumpsteak ist mit dem unbedingt notwendigen Fettrand fast nur noch auf Bestellung zu bekommen, und Schweine scheinen auf fettfrei gezüchtet worden zu sein. Die Schweine früher hatten ein dickes Fettpolster, brauchte man den Speck doch zum Anbraten des Sonntagsbratens, ohne Speck ging’s nicht, und den Sonntagsbraten gab’s sonntags, deswegen hieß er so. Und eine Art Metzger, der heute in Kamen nicht mehr vertreten ist, war Pferdemetzger Weber an der Ecke Kampstraße/Rottstraße (vgl.o.).
Abb. 20: Fetter Speck
Schürmann in der Kirchstraße verkaufte alles um die Milch herum. Butter wurde anfangs von einem großen Klumpen abgestochen und in Pergamentpapier gewickelt. Sonntags öffnete er, damit man sich geschlagene Sahne für den Sonntagsnachtisch holen konnte, natürlich in der mitgebrachten Glas- oder Porzellanschüssel. Mitgebrachte, wieder füllbare Gefäße – wird gerade als ungemein modern wiederentdeckt. Bei der Milch allerdings hatte Schürmann einen harten Konkurrenten, den Milchmann Biermann, der sich mit einer Glocke ankündigte und die Milch an die Haustür brachte. Sein Milchwagen wurde von einem Pferd gezogen, und wir Kinder wurden ermahnt, uns nicht auf die Speichen der Räder zu stellen, eine Bewegung des Pferdes würde zu gebrochenen Knochen führen. Die Milch wurde mit Viertel-, Halb- und Literkellen aus dem großen Aluminiumtank geschöpft und in die mitgebrachte Kanne gefüllt. Später hielt auch hier die Moderne Einzug: die Milch wurde aus dem Tank gepumpt. In einem Schauglas, ähnlich wie heute an der Tankstelle, wurde die gezapfte Menge Milch angezeigt. Wenn zu Hause Milch übrigblieb und sauer wurde – einen Kühlschrank hatte kaum jemand – dann brachte das ein neues, beliebtes Produkt hervor: Sauermilch mit Zucker war für Kinder eine Delikatesse. Und blieb dann immer noch etwas übrig, wurde es in ein feines Leinentuch, meistens eine Leinenwindel (nix mit Einweg-Pampers), geschüttet und über den Spülstein – der war damals in vielen Haushalten tatsächlich noch aus Stein – gehängt, dort wurde die Molke abgeseiht. Dann blieb Schichtkäse über, vielseitig verwendbar, besser als Quark. Der hieß Schichtkäse, weil er verschiedene Schichten aufwies, magere und fettreiche, die an ihrer gelblichen, buttrigen Farbe zu erkennen waren. Gibt’s heute nur noch selten. Aber versuchen Sie das einmal mit der Normalmilch von heute! Länger haltbar um den Preis des plötzlichen Verderbens. Anfang der 1950er Jahre tauchte dann, ganz neu, Joghurt mit Früchten auf.
Abb. 21: Eisstange hochkant
Auch wenn es kaum Kühlschränke gab, nur in wenigen Haushalten ein kleiner, mit Gas betriebener stand, ohne Kühlung brauchte man nicht auszukommen. Dafür sorgte der Eismann, der nicht Tiefkühl-Fertigkost ins Haus lieferte, sondern Eis in halben oder ganzen Stangen, die im Winter aus Seen ausgesägt worden waren, und zu Hause in den Kühlkeller oder die -kiste kamen und monatelang Kühle abgaben. Die Stangen wurden mit Eispickeln aus dem Wagen gezogen und auf der Schulter, geschützt durch ein Leder, ins Haus getragen.
Abb. 22: Alte Waage
Gemüse kaufte man auf dem Markt, dann kam es direkt von Bauern aus den umliegenden Dörfern. Hier wurde noch der Urtyp Waage benutzt: zwei Waagschalen mußten durch Ware und Gewichte ins Gleichgewicht gebracht werden. Wiegen aufs Gramm genau war nicht möglich und auch nicht nötig. Spezielle Gemüseläden gab es in der Weststraße: Becker; in der Oststraße: Wolf; und natürlich in der zentralen Weststraße: Otto Kefenbaum, direkt gegenüber dem Alhambra-Theater, einem Kino, und der Einmündung der Kampstraße. Bei ihm gab es außer Gemüse noch Fisch, was man deutlich riechen konnte. Links und rechts der Ladeneingangstür stand je ein Faß Salzheringe. Frischen Fisch gab’s freitags, eingelegte Fische wie Bismarckhering, Rollmops und Brathering wurden stückweise verkauft, Sild wurde abgewogen. Aus Fässern gab’s auch Sauerkraut, Schnibbelbohnen und Gurken, aber nicht so kleine wie heute zumeist, sondern solche mit mindestens 10 cm Länge, die einzeln verkauft wurden. Alles was man aus dem Laden nach Hause trug, fand Platz in der Einkaufstasche aus festem Material, extra für diesen Zweck entworfen und hergestellt. Und darinnen befand sich immer ein ganz klein zusammengefaltetes, stark dehnbares Einkaufsnetz für den Fall, daß der Einkauf mal größer wurde.
Was im Gemüseladen nicht angeboten, weil nicht gekauft wurde, das waren Kartoffeln. Die wurden direkt vom Bauern bezogen, zentnerweise als Lagerkartoffeln, die in der Kartoffelkiste im Keller aufbewahrt wurden. Unten hatten diese Lattengestelle aus Holz eine schräge Lade, aus der die einzelnen Kartoffeln genommen werden konnten. Die Keller waren damals, anders als heute, unbeheizt – Partykeller gab es nicht –, daher hielten die Kartoffeln über den Winter. Wie kamen die Kartoffeln in den Keller? Wie die Eisstangen auf den Schultern kräftiger Kerle. Einen Zentnersack Kartoffeln in den Keller zu wuchten, das brauchte starke Schultern. Die Bauern waren damit frühe Lieferdienste, gewissermaßen der Zeit weit voraus.
Abb. 23: Karoffelhorde
Zu trinken gab es natürlich Bier, aber eine Flasche Bier am Abend zu Hause, das war noch nicht die Regel. Wer zu Hause Bier trinken wollte, ging mit einem Krug zur Kneipe und ließ ihn vom Wirt füllen. Dafür gab es im Eingangsbereich die kleinen Fenster als Durchreiche. Viele, vielleicht die meisten Kamener aber tranken ihr Bier und Korn gleich in der Kneipe. Davon hatte Kamen viele, eine auf ca. 280 Einwohner. Wer Durst hatte und keinen Alkohol trinken wollte, trank Wasser, aus dem Hahn natürlich. Mineralwasser in Flaschen war den meisten zu teuer. Limonaden gab es, waren aber eher das Getränk der Wahl für Jugendliche in Kneipen, Alkohol gab es für sie auch damals nicht. Im Normalfall. Die heute allgegenwärtigen Anderthalbliterflaschen überzuckerter Limonaden gab es gar nicht, auch wenn Bluna und Sinalco schon damals ganz schön süß waren. Saft hatte man auch zu Hause, aber der stammte oft aus der Süßmosterei Enss an der Nordenmauer. Dorthin brachte man sein Obst und nahm „seinen“ Saft wieder mit nach Hause.
Geraucht hat die Mehrzahl der Männer, meist Zigaretten ohne Filter. In der direkten Nachkriegszeit baute jeder, der einen Garten hatte, seinen eigenen Tabak an, seinen Knaster, schaffte sich eine Schneidemaschine an, schnitt und drehte selber. Der Tabakschnitt in Heimarbeit produzierte natürlich den relativ groben Krüllschnitt. Später ging man dann zu Tschorn, der in der Weststraße zwei Läden betrieb und kaufte Zigarren, Zigaretten und Tabak. Aber er hatte natürlich auch Pfeifen und Feuerzeuge im Angebot. Immer brannte eine Flamme auf dem Verkaufstresen, damit der Raucher sich gleich eine anstecken konnte. Teure Zigarren waren den wohlhabenderen Rauchern vorbehalten, wer Geld beim Rauchen sparen wollte oder mußte, begnügte sich mit der 10-Pfennig-Fehlfarbe. Weil Zigarren ziemlich lange brennen, sah man viele Männer zigarrerauchend durch die Stadt gehen. Heinrich Neuhaus von Gardinen-Neuhaus in der Bahnhofstraße hatte, glaube ich, eine Ausbuchtung auf der Oberlippe, weil dort immer eine Zigarre eingeklemmt war. Rauchen war eine gesellschaftlich akzeptierte Gewohnheit, wurde nicht in Frage gestellt. An Gesundheit dachte bei dem Thema eigentlich niemand. Als Jugendliche kauften wir, mangels ausreichend Geld, in der Regel nur die Fünfer-, später Sechserpäckchen z.B. Astor für 50 Pfennige.
Abb. 24: Stannat & Schwakenberg
Sicherlich konnte man auch Wäsche und Kleidung in der Stadt kaufen. Stannat, erst ganz klein in der Weststraße, dann im Neubau, war eine erste Adresse, aber auch Schwakenberg hatte ein gutes Angebot. Kleider, Röcke und Blusen waren in der Regel passend erhältlich, Schürzen und andere Arbeitskleidung sowieso. Doch einen Anzug von der Stange gab es, wenn überhaupt, nur in wenigen Standardgrößen, die nicht vielen Leuten paßten. Selbst zur Konfirmation bekamen viele einen maßgeschneiderten Anzug, weil es im Laden keinen passenden ab.
Abb. 25: Klus in der Weststraße vor 1974
Zum Schuhkauf gingen die Kamener zu Wolter. Der Laden stand an einer günstigen Stelle im Stadtzentrum, in 1a-Lage, an der Stelle des früheren Schützenhofs am Eingang zum Schützenhofplatz, dann Neumarkt, seit 1993 Willy-Brandt-Platz, mit einer markanten Platane vor dem Geschäft. Eine Neuerung faszinierte besonders: ein Röntgengerät, das das Fußskelett zeigte und wie genau es in den Schuh paßte. Dann allerdings verschwand es plötzlich, weil allen Beteiligten dämmerte, daß das extrem gesundheitsschädlich war. Aber natürlich war Wolter nicht der einzige Schuhladen, Erwin Klus hatte sogar zwei, einen in der Bahnhofstraße (heute ist ein Friseur darin) und einen in der Weststraße. Und wenn Schuhe repariert werden mußten, meist war das eine neue Besohlung, ging man z.B. zu Erich Hacheneier am Anfang der Oststraße, gleich vorne links, wo heute eine Spielhalle steht. Schuhe reparieren zu lassen, war damals noch möglich. Und in der Nachkriegszeit mußten die Sohlen lange halten, länger als sonst, weil Geld und Material knapp waren. Damit sie möglichst lange hielten, wurden die Sohlen oft mit gebogenen Eisen an der Schuhspitze, manchmal auch an der „Hacke“, versehen. Das klapperte ganz schön, als ob man Hufeisen trüge. Viele, vielleicht die meisten Schuhe heute können, wenn sie beschädigt sind, nur noch weggeworfen werden, weil sie aus Plastik sind, geklebt statt genäht und zum Teil aus Gußmaschinen stammen. Und heute sind, was früher Turnschuhe hieß, an den Füßen aller Altersklassen zu sehen, vor allem außerhalb von Turnhallen.
Abb. 26: Erich Hacheneier mit Lehrling und Gesellen in seiner Werkstatt
Wäsche, Bettwäsche gab es bei Heinecke und Brockmann. Bei diesem konnte man auch Bettfedern reinigen lassen, wenn sie begannen, durch vielen Gebrauch und Schwitzen zu verklumpen. Eiderdaunen waren viel zu wertvoll, sie einfach wegzuwerfen (heute wohl euphemistisch „entsorgen“ genannt).
Natürlich brauchte man immer auch Nägel und Schrauben und Werkzeug, obgleich nur wenig weggeworfen wurde, alles ständig wiederverwendet wurde. Krumme Nägel wurden z.B. auf einem Stück Metall, einem Amboß, geradegeschlagen und gingen wieder ins Holz rein wie geschmiert. Alles aus Metall kaufte man bei Bohde, wie heute immer noch – seit 1874, heute das älteste Geschäft Kamens, 2024 150 Jahre alt –, oder bei Frieling in der Nordstraße. Beide hatten auch eine Schlosserei, die alles Mögliche auf Bestellung anfertigte. Bei Bohde waren anfänglich Waagen der Renner.
Abb. 27: Eine ganz frühe Annonce für Wienpahl & Bohde
Für Spielzeug und Fahrräder, auch für deren Reparatur, ging man zu Karrenberg in der Weststraße. Bücher gab es bei Hagena und bei Otto Wörtz, der ein Buchhändler war, wie er „im Buche stand“. Und weil das so war, traf sich ein Großteil der Lehrer des Gymnasiums in seinem Buchladen an der Bahnhofstraße/Ecke Grüner Weg und stand dort stundenlang herum, um zu diskutieren. Fast jeden Nachmittag traf man dort Oberstudiendirektor Walter Schwabe, Kunstlehrer Otto Holz, Fremdsprachenlehrer Dr. „Natz“ Werner, auch „Heine“ Flaskamp, „Jupp“ Hoischen u.a. Otto Wörtz, sparsamer Schwabe, der er war, sparte viele Jahre lang, bis er sich das Ich-weiß-nicht-wie-viel-bändige Schwäbische Wörterbuch für über DM 1.000,00 leistete. Ein lebenslanger Herzenswunsch ging in Erfüllung.
Abb. 28: Otto Wörtz’ Buchhandlung an der Ecke Bahnhofstraße – Grüner Weg
Abb. 29: Otto Wörtz’ Werbung in den frühen 1950er Jahren
Ein Photogeschäft gab es in Kamen schon seit 1893. Aus Dortmund kam Ernst Braß hierher, weil er sich selbständig machen wollte (und weil er sich so stark am Orte engagierte, sich um Kamens Geschichte kümmerte, die Einrichtung des ersten Kamener Museums betrieb, wurde er auch der erste Kamener Stadtarchivar, ehrenamtlich). Seinen ersten Laden eröffnete er im Hause Bahnhofstraße 12 (Anm.: 2016 oder 2017 abgerissen, durch das Holhaus der Volksbank ersetzt), bevor er sein eigenes Haus Bahnhofstraße 49 baute. 1934 übernahm Konrad Holzer diesen Laden. In den 1950er/60er Jahren gab es wohl kaum einen Haushalt in Kamen und der näheren Umgebung, in dem nicht mindestens ein Photo von Photo-Holzer hing: Hochzeit, Geburt, Einschulung, Kommunion, Konfirmation, Silber- und Goldhochzeit, an was man sich eben so erinnern wollte. Dazu gehörten auch die Urlaubsfilme: einen 36er Film zu verknipsen, dazu brauchte es oft einen ganzen Urlaub, man mußte etwas sparen, sich überlegen, welches Motiv sich lohnte. Und bevor man Kopien bestellte, ließ mancher erst einmal einen Kontaktstreifen herstellen, suchte dann sorgfältig aus, welche Bilder auf Dauer Bestand haben würden, zum Vorzeigen und als Erinnerung. Unvorstellbar heute, in einer Zeit, da jedes noch so nichtige Ereignis auf den Chip gebannt wird. Kostet ja nix. Ob durch die Digitalisierung wirklich immer alles verbessert wurde?
Abb. 30: So warb Ernst Brass im Oktober 1901 für sein neues Geschäft
Abb. 31: Und so sah Photo Holzer Anfang der 1950er Jahre aus, vor dem Umbau
Es ist merkwürdig. Die Moderne brachte viele Neuerungen. Alles wurde verpackt, damit wurde Selbstbedienung möglich. Dann brauchten wir keine Einkaufstaschen mehr, alles wurde in Plastiktüten nach Hause getragen. Wir gingen lieber in den Supermarkt als auf den Markt, dort war es den meisten zu teuer. Und jetzt? Der neueste Schrei ist es, lose Ware in eigene Gefäße füllen zu lassen, um die Verpackung, und damit Müll, zu vermeiden. Die Plastiktüte ist seit Jahren verboten, wir haben wieder Einkaufstaschen. Wir kaufen vermehrt auf dem Markt oder gar direkt beim Bauern, weil wir regionale oder lokale Produkte bevorzugen, umweltbewußt wie wir sind. Der Trend ist deutlich. Ist vieles aus der alten Zeit modernefähig? Ist das Alte oft auch das Neue?
Daß Kamener Kaufleute bei Kamener Kaufleuten einkauften, war selbstverständlich. Geben und Nehmen gehörten zusammen, die Loyalität war groß. Jeder wußte, daß man aufeinander angewiesen war. Und die Stadt profitierte vom Bürgersinn.
Schon seit langem heizen wir unsere Wohnungen mit Öl oder Gas. Damals war Kohle das Hauptheizmaterial, und wenn’s warm sein sollte, mußte ordentlich „gestocht“ werden, mit einem „Prokeleisen“. Öl kam erst langsam auf, wurde nur in einzelnen Öfen verbrannt, machte weniger Dreck, stank aber langanhaltend. Alle Häuser hatten einen Kohlenkeller, und wie kam die Kohle dorthin? Natürlich, wie Eis und Kartoffeln, auf den Schultern des Kohlenmanns, in Zentnersäcken. Die notwendigen Herde und Öfen verkauften Bohde und Brumberg. Und der „kleine Brumberg“ hatte in der Kampstraße 13 auch noch eine Bauschlosserei. Bergleute bekamen ihr Deputat direkt von ihrer Zeche geliefert, alle anderen kauften ihre bei Pothmann in Bahnhofsnähe, der schon bald auch Öl führte, und bei Sander an der Ostenmauer, mit Kohlehof an der heutigen Ostenallee. Aus besonders fetthaltiger Kohle wurde auch Margarine hergestellt, ein Produkt aus Kriegs- und Mangelzeiten, gepresst in Würfeln für 10 Pfennige, nicht besonders gut schmeckend, aber es war Fett, und Fett brauchte man, weil harte körperliche Arbeit unterfüttert werden wollte.
Kohle war damals wichtig, sowohl im Alltag der Menschen wie auch für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Aber konkret hieß das für die Hausfrau: mindestens einmal pro Woche mußten die Fenster geputzt werden, weil sie sonst vom Ruß, der immer in der Luft war, fast undurchsichtig gemacht wurden. Und keine Hausfrau konnte sich das leisten, die Nachbarinnen paßten auf. Und das galt auch für die Wäsche. Einmal im Monat war „große Wäsche“. Da wurde in der Waschküche der große Waschkessel angeheizt, das dauerte Stunden. Dann kam die Wäsche hinein, mußte von Hand gerührt werden, lange, das war anstrengend. Später gab’s dann Erleichterung der Arbeit: die Waschmaschine mit Wassermotor, die sich aber nicht lange hielt, sie war zu verschwenderisch. Hängte man die Wäsche ins Freie, Wäschetrockner gab’s natürlich nicht, brauchte man Glück: wehte der Wind aus der falschen Richtung und gab es an der Kokerei gerade einen Abstich, konnte man die Wascherei gleich wieder von vorn beginnen. Und der weiße Hemdkragen vom Morgen war der schwarze Hemdkragen vom Mittag, Wechselkragen also durchaus sinnvoll. Und am Abend fragte die Mutter immer: „Hast Du Dir den Hals und die Ohren gewaschen?“ Wenn nicht, hätte die dunkle Schicht darinnen für die Anlage eines Biotops gereicht.
KH
Textquellen:
- Beyer, Ernst, „… der kommt doch aus den Zechenhäusern. 100 Jahre Wohnen und Leben in Zechensiedlungen“ (1888 – 1988) Bochum 2001
- Buschmann, Friedrich, Geschichte der Stadt Camen, Camen 1841
- Pröbsting, Friedrich, Geschichte der Stadt Camen und der Kirchspielsgemeinden von Camen, Hamm 1901
- Pröbsting, Friedrich, Erinnerungen aus meinem Leben, Würzburg 1914
- Dokumente aus der Geschichte der Stadt Kamen, Hrsg. Stadt Kamen, Stadtarchiv, Kamen 1984, Blatt 3b
- Siegler, August, Die Entwicklung der Stadt Kamen. Rückblick, Vergleich, Ausblick. Rückblick auf 50 Jahre: 1873 – 1926. Abgedruckt in: Zechenzeitung1926/27 (in 7 Folgen), Folge 3
Bildquellen:
- Stadtarchiv: 1,2,5,6,9,10,11,15,24,25,26,28
- unbekannt: 3,4,23
- Planet Wissen: 7
- Archiv Klaus Holzer: 8
- Archiv Wilfrid Loos: 12,13
- Photo Klaus Holzer: 14,16,17
- Wikipedia: 18
- Eis Winter Rhein-Main: 21
- Fleisch- & Wurstwaren: 20
- shop.mueller-fleischerei.de: 19
- Photo Kathrin Nadzeika: 22
- Camener Zeitung 22. Jan. 1875: 27
- Camener Zeitung Okt. 1901: 30
- Festschrift 1953: 29
- Photo Holzer: 31